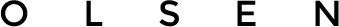Wenn von Netzteilen – speziell PC-Netzteilen – die Rede ist, fällt häufig der Begriff Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad lässt sich im Allgemeinen für viele verschiedene Geräte oder Maschinen bestimmen. Hierbei kann es sich um chemische, elektromagnetische, thermische oder andere Energiearten handeln.
Der Wirkungsgrad kennzeichnet das Verhältnis zwischen zugeführter und abgegebener Leistung. Bei Netzteilen werden besonders für leistungsstarke Rechner also Netzteile bevorzugt, die die zugeführte Energie maximal ausnutzen. Mit dem Wirkungsgrad kann allgemein die Differenz zwischen der abgegebenen und zugeführten Energie berechnet werden – die Differenz dieser Werte ergibt dann die Verlustleistung.
Geräte und Maschinen aller Art können die zugeführte Energie nicht komplett wieder abgeben. Es entstehen also immer Verluste bzw. Verlustleistungen, da ein Teil der Energie immer als Wärme abgegeben oder durch Reibung umgewandelt wird. Der Wirkungsgrad liegt also nie bei 100 Prozent. Hochwertige Netzteile weisen einen Wirkungsgrad von mehr als 80 Prozent auf.
Was ist eine elektronische Schaltung?
Auch in Zusammenhang mit Netzteilen und Ladegeräten werden häufig elektronische Schaltungen oder auch Ladeschaltungen erwähnt. Diese steuern den Ladevorgang. Unter einer elektronischen Schaltung versteht man einen Zusammenschluss verschiedener elektronsicher Bauelemente, die im Verbund einen bestimmten Zweck erfüllen wie beispielsweise die Steuerung des Ladevorgangs. Bei den elektronischen Bauelementen kann es sich unter Anderem um Dioden und Transitoren handeln. Elektronische Schaltungen kommen vielerorts zum Einsatz – beispielsweise in Computern, Fernsehern oder eben in Ladegeräten.
Die elektronische Schaltung ist nicht zu verwechseln mit der elektrischen Schaltung, die sich nicht aus elektronischen Bauelementen zusammen setzt, sondern aus elektrischen Komponenten wie Motoren und Schaltern.
Elektronische Schaltungen (wie auch elektrische Schaltungen) werden mithilfe eines sogenannten Schaltplanes dargestellt. Schaltpläne hat bestimmt jeder schon einmal gesehen: Sie stellen die Anordnung grafisch dar. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein tatsächliches Abbild des Schaltplans, sondern um eine abstrahierte Darstellungsform. Zu den bekanntesten Schaltplänen gehört der Stromlaufplan.
Was passiert bei einem Kurzschluss?
Von einem sogenannten Kurzschluss hat sicher schon jeder einmal etwas gehört. Bei einem Kurzschluss kommt es zu einer Verbindung von zwei Polen der Spannungsquelle, wobei keinerlei Widerstände existieren. Die Spannung fällt dann auf Null.
Verschiedene Ursachen können zu einem Kurzschluss führen. Hierzu gehören Isolationsänderungen und Isolationsbrüche, die unter Anderem durch Alterung hervorgerufen werden. Auch durch Kriechwege eindringendes Wasser oder eine Überhitzung können einen Kurzschluss auslösen. Durch einen Kurzschluss können weitere Isolationsschäden entstehen.
Zu den bekanntesten Maßnahmen gegen Kurzschlüsse zählen Sicherungen. Die Magnet- und Schmelzsicherungen werden in den Stromkreis integriert: Die Sicherung unterbricht den Stromkreis, wenn die Stromstärke für eine bestimmte Zeit einen hohen Wert überschreitet. Durch die durchbrennende Sicherung soll verhindert werden, dass der angeschlossene Verbraucher, also ein Gerät wie der Fernseher, bei einem Kurzschluss in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn es zu einem Kurzschluss kommt, geht die Sicherung kaputt oder brennt durch und muss ersetzt werden. Bei Magnetsicherungen wird der Stromkreis ebenfalls unterbrochen, wenn bestimmte Spannungswerte überschritten werden – der Stromkreis kann allerdings wieder aktiviert werden, ohne dass die Sicherung getauscht werden muss.
Welche Stromstärken gibt es?
In Zusammenhang mit Netzteilen und elektrischen Geräten wird häufig die sogenannte Stromstärke aufgeführt. Die Stromstärke gibt an, wie viele Elektroden oder Ionen, also elektrische Ladungen, in einer bestimmten Zeit in Bewegung sind. Die Stromstärke wird immer in Ampere angegeben und beispielsweise mit 10 A abgekürzt.
Die Stromstärke in Ampere wird aus folgenden Werten gerechnet: Ladung, Zeit, Stromdichte und Fläche. Eine durchschnittliche Stromstärke kann auch aus den Werten für die Ladung und der benötigten Zeit errechnet werden. Als Grundeinheit für Stromstärken wird 1 A, also ein Ampere, verwendet.
Sogar bei der Kontraktion menschlicher Muskeln ist Strom messbar. Dieser liegt bei etwa 10 Milliampere. Eine Glühlampe setzt etwa 430 Milliampere Strom frei. Die Grundeinheit von einem Ampere wird von einem Zitteraal erreicht. Sicherungen im Haushalt haben etwa 16 Ampere und Elektromotoren 150 Ampere. Hohe Stromstärken werden in Kiloampere ausgedrückt: Ein Blitz kommt auf etwa 300 Kiloampere. Es gibt auch sehr geringe Stromstärken, die nur noch in Mikroampere messbar sind – zum Beispiel der einer Fotozelle oder Quarzuhr.